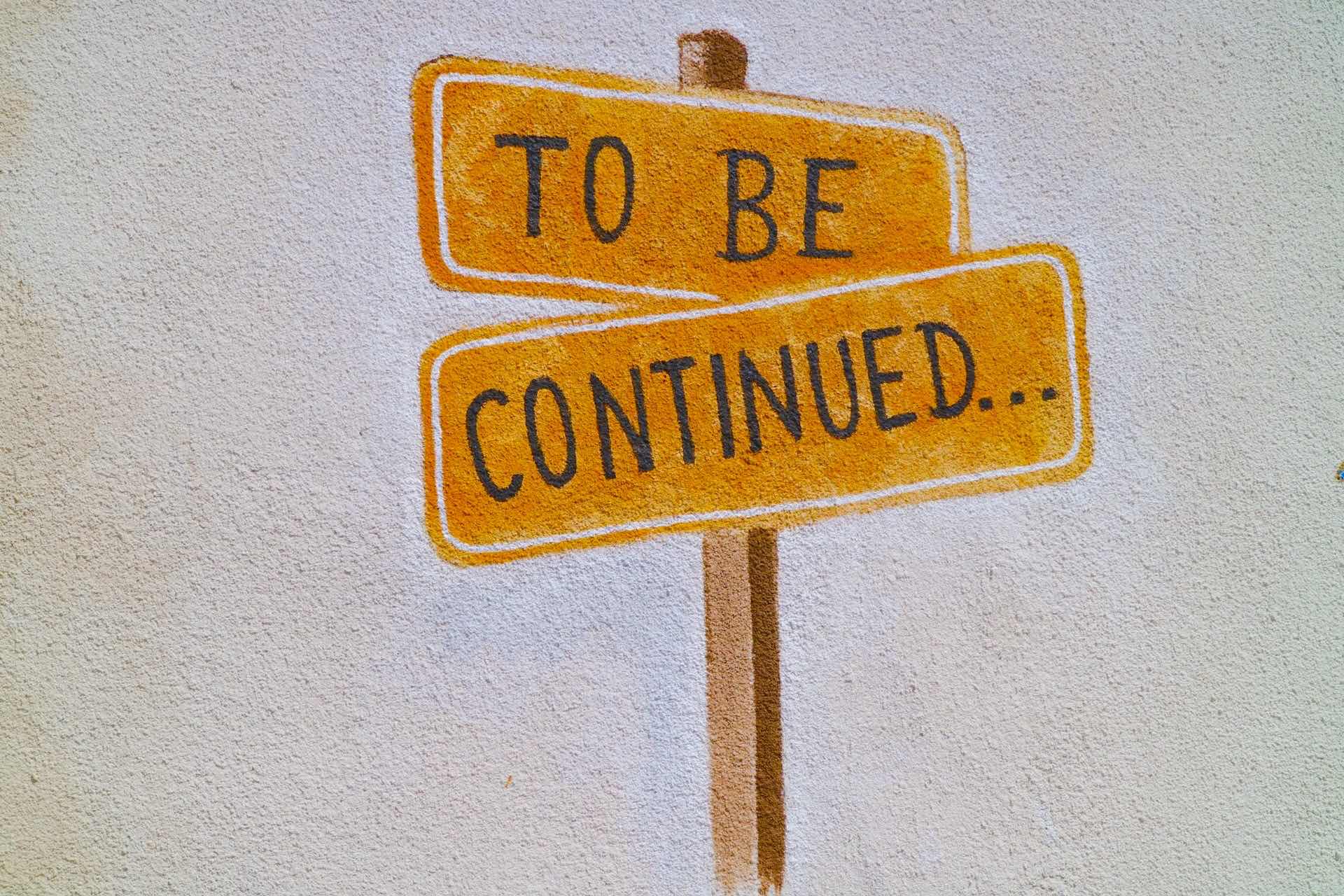Ende 2005 habe ich gemeinsam mit einer Freundin ein Haus gekauft, in dem jede von uns ihre eigene Etage bewohnt. Wir hatten damals beide feste Arbeitsstellen – ich war Sekretärin in einem großen Unternehmen, Gisela arbeitete als Pädagogin in einer Kindereinrichtung. Als Singlefrauen standen wir beide „mit beiden Beinen“ im Leben, wollten selbiges miteinander teilen und gerne gemeinsam alt werden. Wir waren das perfekte Team – Gisela als handwerklich begabte Frau und ich mit meinen kaufmännischen Fähigkeiten.
Aufgrund von Mobbing kam es dann Anfang 2008 bei Gisela zu einem Totalabsturz inklusive Suizidversuch, der unser gemeinsames Projekt ganz schön durchrüttelte. Gisela hatte große Angst, dass ich jetzt aufgeben würde, weil ich nicht weiter mit einem „Psycho“ zusammenleben wollte – ich jedoch machte mir eher Sorgen darüber, wie sie wieder auf die Füße kommen könnte. Ich erinnere mich noch gut an unsere erste Begegnung im Krankenhaus. Sie schaute mich an und sagte: „Naja, das war’s dann wohl mit unserem Zusammenleben.“ Da kannte sie mich aber schlecht! Aufgeben war noch nie mein Motto gewesen, und so antwortete ich ihr: „Wie kommst du denn auf die Idee? Das steht gar nicht zur Diskussion. Aber ich möchte, dass du eine Therapie machst, das angehst und bearbeitest. Ich glaube daran, dass wir das dann gemeinsam hinkriegen.“
Ich kann nur begrenzt helfen, kann da sein, begleiten und ermutigen, aber ich bin nicht der Heiler und schon gar nicht der Retter.
Inzwischen sind 15 Jahre vergangen und wir wohnen immer noch zusammen und leben „unser“ Projekt. Es war ein großes Stück Arbeit bis hierher, aber ich habe die Entscheidung, gemeinsam weiterzumachen, nie bereut. In der tiefsten Phase der Depression hat Gisela immer wieder gesagt: „Ich lebe eigentlich nur noch wegen dir“. Ich habe diese Aussage immer stehen gelassen und nie versucht, ihr einzureden, dass sich das unbedingt ändern muss, sondern immer nur geantwortet: „Ja, dann ist das eben im Moment so – das wird auch wieder anders.“ Ich habe fest daran geglaubt – und nach anderthalb Jahren war die schlimmste Zeit vorbei.
Gisela ist inzwischen dauerhaft berentet und muss mit einigen psychischen Einschränkungen leben. Oft kämpft sie mit depressiven Verstimmungen, und auch Reizüberflutung ist immer wieder ein Thema, wenn zu viel auf einmal kommt. Aber sie ist gut medikamentös eingestellt und stabil, wenn sie sich an einige Regeln hält und danach lebt. Wir haben ein echt gutes Leben miteinander und ich empfinde für mich persönlich keinerlei Einschränkungen, wenn auch ich mich an bestimmte Regeln halte.
Das geht ohne Frage jedem so, der in einer ähnlichen Situation lebt – ob nun mit einer Freundin oder einem Freund, dem Ehepartner oder einem erkrankten Kind oder Elternteil. Nachfolgend daher drei wichtige Eckpfeiler, die sich aus unserer Sicht für ein funktionierendes Zusammenleben bewährt haben:
1. Die Grenzen des Kranken akzeptieren
Gisela hat eindeutig andere Grenzen als ich. Situationen, die in mir nicht das kleinste Quäntchen Stress auslösen, können für sie unter Umständen eine riesige Herausforderung darstellen – und das nicht nur aufgrund unserer unterschiedlichen Persönlichkeit. Während ich mich beispielsweise in größeren Menschengruppen lediglich ein wenig mehr konzentrieren muss, um mich in ihnen gut bewegen zu können, lösen sie in Gisela wahre Stürme von Reizüberflutung aus, die sie unfähig machen, sich überhaupt in dieser Gruppe länger aufzuhalten. Das kann und muss ich als Gesunder nicht verstehen und nachvollziehen können, aber ich muss akzeptieren, dass es so ist, und damit umgehen lernen. Sätze wie „Stell dich nicht so an!“ oder „Jetzt reiß dich aber mal ein bisschen zusammen!“, helfen hier genauso wenig wie einem ans Bett Gefesselten zu sagen: „Jetzt lass dich nicht so hängen und steh endlich mal auf!“ Es braucht viel Gespräch und Austausch, wenn das Miteinander gut funktionieren soll. Ich muss Giselas „Baustellen“ kennen, um etwaige Reaktionen einordnen zu können und auch selbst entsprechend adäquat reagieren zu können. Dann kann ich sie zum Beispiel auch zur Seite nehmen, wenn mal wieder zu viel auf sie einstürmt, was sie nicht verarbeiten kann.
Für manche Bereiche meines Lebens, die mir sehr wichtig sind, musste ich mir andere Sparringspartner suchen. So führe ich zum Beispiel gerne längere theologische Gespräche, was Gisela zum einen noch nie besonders gern mochte, was sie nun aber aufgrund der Medikamente, die sie nehmen muss, auch gar nicht mehr schafft. Sie kann sich nicht so lange konzentrieren, wie ich reden kann – längere Debatten ermüden sie noch schneller als vorher. Das hat nichts mit Desinteresse zu tun, sondern der Tank ist einfach schneller leer als bei mir. Wenn ich das akzeptieren kann, werde ich es nicht persönlich nehmen, wenn sie nicht mehr zuhört. Um sie nicht zu überfordern, habe ich mir andere Menschen gesucht, die theologische Diskussionen genauso lieben wie ich – und Gisela ist froh, dass ich weiter auf meine Kosten komme und fühlt sich nicht unter Druck, mir hier etwas geben zu müssen, was sie einfach nicht kann.
PRAXISTIPP „ERWARTUNGEN ÜBERDENKEN“
Suchen Sie sich für die Bereiche, die Ihnen wichtig sind (Gespräche, Sport etc.) und in denen der Erkrankte Ihnen kein Gegenüber mehr sein kann, einen anderen „Sparringspartner“, damit Ihre Bedürfnisse nicht ungestillt bleiben und sich bei niemandem Frust aufbaut.
2. Die eigenen Grenzen akzeptieren
Mindestens genauso schwierig, wie Giselas Grenzen zu akzeptieren ist es, meine eigenen Grenzen wahr- und anzunehmen und damit umzugehen. „Ich bin nicht der Messias!“ – wie oft habe ich mir selber diesen Satz gesagt, wenn ich mal wieder mehr von mir wollte, als im Augenblick möglich war. Sei es, dass ich gespürt habe, dass meine Kraft für eine bestimmte Sache einfach nicht ausreicht oder ich mich dafür zuständig fühle, dass Gisela neue Lebensfreude und Lebensmut bekommt. Ich kann nur begrenzt helfen, kann da sein, begleiten und ermutigen, aber ich bin nicht der Heiler und schon gar nicht der Retter. Meine Hilfsmöglichkeiten haben Grenzen, und es tut gut, mich immer wieder daran zu erinnern, weil ich mir sonst selbst Lasten auferlege, die mich erdrücken und letztlich gänzlich handlungsunfähig machen. Auch hier muss ich mit Gisela im Gespräch sein und ihr sagen, wenn es mir gerade zu viel wird.

Nicht immer bin ich so verständnisvoll, wie ich gerne wäre, obwohl ich um ihre Erkrankung weiß. Das grundsätzliche „Ja“ zu unserem Tandem heißt ja nicht automatisch, dass ich immer alles fröhlich meistern kann und es nicht auch einmal Frust gibt. Auch ich bin nur ein Mensch mit Fehlern und Schwächen – das muss ich akzeptieren lernen.
PRAXISTIPP „EIGENE GRENZEN AKZEPTIEREN“
Halten Sie immer mal wieder inne und prüfen Sie für sich, ob Sie sich noch in Ihren Grenzen bewegen und sich nicht selbst mit unerfüllbaren Erwartungen überfordern. Hier kann auch das Gespräch mit einer externen Person helfen, mit der Sie reflektieren können und die Ihnen Feedback gibt.
3. Die Grenzen des Umfelds akzeptieren
Viele Menschen haben mit psychischen Erkrankungen große Schwierigkeiten, da man sie nur schlecht erklären kann. Gisela hat ja keinen Gips oder einfach eine Erkältung – vertraute Diagnosen, die man kennt und entsprechend einsortieren kann. Depressionen gelten in unserer Gesellschaft immer noch als „irgendwas Seelisches“, das eben labile Menschen bekommen, die sich im Leben nicht zurechtfinden. Psychische Erkrankungen verunsichern und/oder überfordern viele Menschen, denn die Krankheitsbilder sind ihnen fremd und unbekannt. Alles, was mir jedoch fremd und unbekannt ist, macht mir zunächst mal Angst. Die Psyche ist ja auch nicht einfach zu (be-)greifen, und so vieles, was sie betrifft, nicht zu erklären.
Psychische Erkrankungen verunsichern viele Menschen, denn die Krankheitsbilder sind ihnen fremd und unbekannt. Die Psyche ist ja auch nicht einfach zu (be-)greifen, und so vieles, was sie betrifft, nicht zu erklären.
Glücklicherweise haben wir viele Freunde, die gut mit psychischen Erkrankungen umgehen können, aber wir stellen auch immer wieder fest, dass Menschen nicht bereit sind, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Oft werden Äußerungen über Kranke oder sogar gegenüber dem Kranken schlichtweg aus Unwissen, aber auch aus Arroganz oder Dummheit getätigt, die mitunter überaus verletzend sein können. Wir können unser Umfeld natürlich nicht zwingen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber wir können Partei für die Kranken ergreifen und da, wo es möglich ist, für Aufklärung sorgen. Dennoch werden wir in unserer Gesellschaft damit leben müssen, dass es immer wieder Menschen in unserem Umfeld geben wird, bei denen wir auf Unverständnis stoßen werden oder auch auf Menschen, die mit dem Kranken und der Situation einfach nicht umgehen können. Wenn sie sich aus unserem Umfeld zurückziehen, dann häufig aufgrund von Überforderung und Hilflosigkeit.
Wichtig war uns beiden immer, dass wir Menschen in unserem Umfeld haben, die unsere Beziehung im Blick behalten. Die aufpassen, dass wir nicht in Schieflage geraten – sich einer von uns zu sehr aufgibt oder den anderen überfordert. Wir selbst sind ja Teil des Systems und bekommen Veränderungen nicht mit – da kann ein Schubs in die richtige Richtung von außen helfen, immer in einem guten Gleichgewicht zu bleiben.
PRAXISTIPP „FREUNDE ENTLASTEN“
Sprechen Sie bei Ihren Freunden offen an, wenn Sie den Eindruck haben, dass sie mit der Erkrankung überfordert sind und bieten sie ihnen die Möglichkeit, ihre Emotionen zu thematisieren. Oft haben andere einfach nicht den Mut, von sich aus etwas zu sagen, weil sie verunsichert sind.